 „Das klingt ein bisschen gequält.“
„Das klingt ein bisschen gequält.“
Diesen Kommentar meines Mannes bekam ich letztens zu hören, nachdem ich als Vorbereitung auf ein Konzert aus vermeintlich voller Brust einen meiner Songs herausgeschmettert hatte. Im Anschluss leitete er mir freundlicherweise die Tipps seines Chorleiters weiter, wie ich meine Resonanzräume öffnen könne.
Ich gebe es ungern zu, aber im ersten Moment war ich eine winzige Kleinigkeit „angebiselt“. Schliessich bin ICH in unserem Haushalt die semi-professionelle Sängerin und habe jahrelangen Gesangsunterricht genossen. Frei nach Trappatoni: „Was erlauben Mann?“
Ich habe dann der beleidigten Leberwurst in mir mit einem giftigen Kommentar à la „Ach, ein halbes Jahr im Chor und schon der grösste Besserwisser“ Tribut gezollt. Nach dieser kleinen Ventil-Aktion fragte ich aber genauer nach, und es entspann sich eine hilfreiche Diskussion. Ich nahm mir vor, wieder mehr an meiner Technik zu arbeiten – schliesslich will ich noch besser werden.
Abgesehen davon, dass mir diese heitere Episode gezeigt hat, wie empfindlich man reagieren kann, wenn man kritisiert wird, hat mich das Ganze zu einer anderen Frage geführt:
Ist es gesund, immer besser werden zu wollen?
Ich glaube, der Drang nach Perfektion und Exzellenz ist dem Menschen von Natur aus gegeben, und wenn man in einem Bereich etwas Besonderes erreichen will, ist eine gewisse Besessenheit ganz nützlich. Dennoch ist dieser Drang ein zweischneidiges Schwert – gerade, wenn der Vergleich hinzukommt.
Die Forderung nach Leistung gehört zu unserer Gesellschaft, und da Erfolg oft mit der „besten Leistung“ gleichgesetzt ist, gerät die Frage nach meiner Leistung in Beziehung zu der von anderen in den Vordergrund. Mir fallen in letzter Zeit zwei entgegengesetzte Philosophien ins Auge, wie man ungesund mit diesem Drang nach Leistung und Vergleich umgehen kann.
Die erste, die Ausweichtaktik, nenne ich nach einer Folge von „How I met your mother“ einmal „Pokale für alle“. Erziehungsphilososophisch wird aus dieser dem olympischen Gedanken abgeguckten Idee, dass mitmachen alles ist, die Haltung, dass schon das Auftauchen belohnt zu werden hat und dass nichts, was ein Kind oder Jugendlicher tut, bewertet werden darf. Was immer es tut, ist toll. Dummerweise läuft es so später nicht. Wenn ich eine Ausbildung abschliessen will, muss ich das vorgegebene Niveau erreichen – schliesslich will niemand einen Arzt oder Handwerker, der herumpfuscht (nicht, dass es das nicht geben würde). Wenn wir Kindern mitgeben, dass jede ihrer Aktionen in sich genial und sie über jeden Zweifel erhaben sind, generieren wir zukünftigen Frust auf allen Seiten. Der Moment wird nämlich kommen, wo es eben nicht reicht, dass sie „da waren“, sondern wo zu Recht eine bestimmte Leistung von ihnen erwartet wird.
Die andere Seite der Medaille ist die Aufzucht von gnadenlosen Konkurrenzkämpfern. In den Augen mancher Eltern genügt es nicht, wenn ihr Kind die Bestnote macht – der Hauptkonkurrent um den Spitzenplatz sollte wenigstens einen halben Punkt darunter liegen oder noch besser die Prüfung versemmelt haben. So ein Kind betrachtet irgendwann alle anderen als Rivalen am Futtertrog und wird erst dann mit sich zufrieden sein, wenn niemand anderes besser ist. Aber was passiert, wenn so ein Highperformer sein Ziel nicht erreicht, weil es – seien wir realistisch – immer irgendwo jemand Besseren gibt? Wenn er plötzlich von der Spitze verdrängt wird? In diesem Weltbild ist jeder Abstieg vom höchsten Platz eine schändliche Niederlage und ein vernichtender Stoss. Wenn ich alles, was ich bin, davon abhängig mache, dass ich zuoberst stehe, kann ich nur verlieren.
Das Problem und die Grundlage für beide falschen Philosophien liegt für mich in der Verknüpfung von Leistung und Wert des Menschen.
Wer seinen Wert von seiner Leistung abhängig macht, wird entweder aufgeben, sich jeder Kritik und Konkurrenz entziehen oder ohne Rücksicht auf Verluste verbissen für seinen Erfolg schuften und dabei alle anderen als Konkurrenten sehen und gnadenlos plattwalzen. Diese Verknüpfung kann also nur Aufgeblasenheit oder Minderwertigkeitsgefühle hervorbringen.
Nur wer seinen Wert aus einer anderen Quelle bezieht, kann befreit nach den Sternen greifen, etwas riskieren und sich Kritik aussetzen, weil er weiss, dass er der gleiche, wertvolle Mensch ist und bleibt – egal, wie gut oder schlecht er mit dem, woran er gerade bastelt, abschneidet. Diesen Wert jenseits meiner Leistung und auch jenseits der Liebe und Anerkennung von anderen Menschen, von der wir uns auch nicht bestimmen lassen sollten, gibt es nur bei Gott. Und wenn ich ihn dort habe, kann mich nicht mehr so viel erschüttern.
Nicht einmal die berechtigte Kritik meines Göttergatten. Deshalb singe ich auch heute wieder befreit vor mich hin – und versuche, meine Resonanzräume mehr zu öffnen.

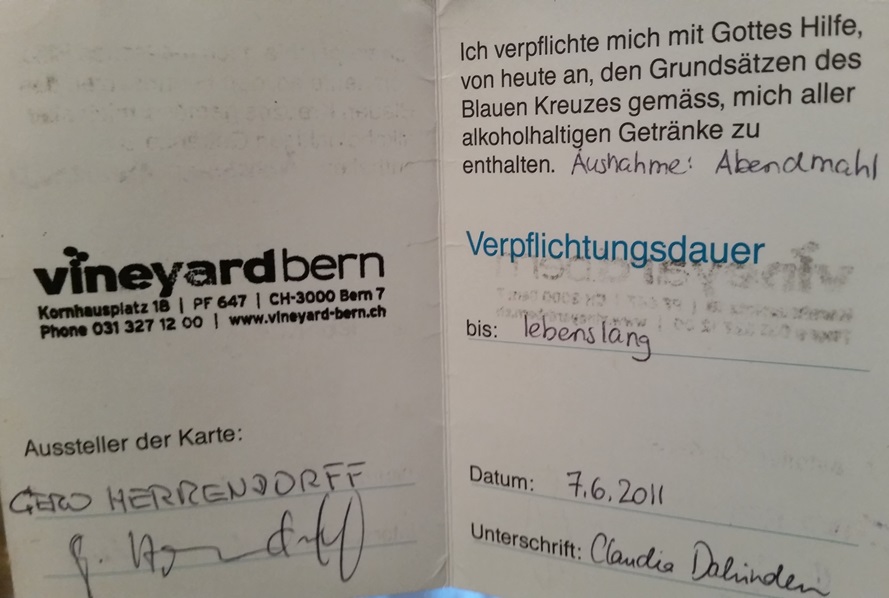











Letzte Kommentare