 Ich stehe gerade mitten in anstrengenden Wochen, jongliere verschiedene Engagements und schreibe gleichzeitig an etwa drei Posts, die noch nicht so sind, wie ich mir das vorstelle. Dann passiert so etwas wie gestern in Paris, und ich frage mich, ob es überhaupt lohnt, irgendetwas zu posten, wenn die Welt von Terror in dieser Größenordnung erschüttert wird.
Ich stehe gerade mitten in anstrengenden Wochen, jongliere verschiedene Engagements und schreibe gleichzeitig an etwa drei Posts, die noch nicht so sind, wie ich mir das vorstelle. Dann passiert so etwas wie gestern in Paris, und ich frage mich, ob es überhaupt lohnt, irgendetwas zu posten, wenn die Welt von Terror in dieser Größenordnung erschüttert wird.
Bildquelle: Pixabay
Mein Newsfeed auf Facebook quillt über vor lauter Posts zum Thema; zum Glück mehrheitlich Solidaritätsbekundungen und nicht hasserfüllte „Nun seid ihr dran“-Posts. Darüber bin ich froh und fühle mich gleichzeitig nur ohnmächtig.
Gerade als Mensch, der so tief an einen Schöpfer glaubt, schmerzen mich der unweigerliche Aufschrei und die Fragen, die wieder an die Oberfläche kommen: „Genau das kommt heraus, wenn Menschen fanatisch an einen Gott glauben!“ „Es gäbe gar keine Kriege ohne diese radikalen Spinner!“ Und als Sahnehäubchen auf jeder Horrortorte dieser Art: „Wie kann Gott, wenn es ihn denn geben soll, so etwas zulassen?“
Ich will gar nicht erst argumentieren, dass wir Christen schon länger nicht mehr diesen Weg der Gewalt beschreiten, auch wenn es wahr ist. Ich glaube fest an den biblischen Satz „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“ und leugne nicht, dass auch der Früchtekorb, den wir Christen der Welt präsentieren, angefaultes Obst und giftige Erzeugnisse enthält.
Was kann ich als gläubiger Mensch tun, wenn diese Fragen kommen? Ist es meine Aufgabe, mich für Menschen zu entschuldigen, die für den Glauben grausamste Verbrechen begehen? Oder erwartet man von mir als halbwegs intelligentem Individuum, dass ich endlich einsehe, dass es Gott nicht gibt und der Glaube an ihn der Welt nichts als Ärger bringt?
Ich glaube, nichts davon ist die Antwort, und was den zweiten Punkt betrifft, habe ich keine Wahl. Ich kann nicht aufhören zu glauben, weil die Menschheit verrücktspielt – das hat sie schon immer getan. Was gerade geschieht, zeigt mir einfach wieder, was für ein Wagnis Gott damit eingegangen ist, uns als Geschöpfe mit freiem Willen zu schaffen. Denn an diesen freien Willen glaube ich.
Gott will, dass wir uns frei entscheiden können und nimmt damit in Kauf, dass wir auch Früchte des Zorns und der Gewalt produzieren. Wir haben jeden Tag die Wahl, was wir aus unserem Leben machen: Wir entscheiden uns zwischen Liebe und Hass, Vergeltung und Versöhnung, Ausharren und Aufgeben, Mut und Angst. Wir formen die kleine Welt um uns herum und manchmal auch die größere. Und als Christen können wir dafür sorgen, dass unser bescheidener kleiner Früchtekorb ein Zeugnis dessen ist, was der Glaube an Gott in unseren Herzen verändert, erzeugt und geschaffen hat.
Ich bin froh, dass mein gestriger Impuls von Wut und Furcht sich nicht weiter in mir ausgebreitet hat. Als ich mir vorhin überlegt habe, was für Entscheidungen wir jeden Tag treffen können, ist mir wieder aufgegangen, dass nicht nur Hass der Gegenpol von Liebe ist. Der wahre Gegenpol von Liebe ist Furcht. Wo Furcht sich ausbreitet, hat Liebe keinen Platz, und wo Liebe herrscht, muss die Furcht weichen.
Dass wir Angst haben, ist zutiefst menschlich – sonst würde im Alten und Neuen Testament nicht so oft „Fürchtet Euch nicht“ stehen. Dass es da so oft steht, zeigt aber auch, wie wichtig es Gott war, dass wir gegen die Furcht angehen, weil sie das Saatkorn des Hasses ist. Wovor ich mich fürchte, das hasse ich, und das zeigt die aktuelle Migrationsdebatte mehr als alles andere.
Am Ende hat Jesus uns auch gezeigt, dass er die Antwort auf unsere Angst ist, als er sagte:
„In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden.“
Dass er die Welt überwunden hat, befähigt mich, in ihr zu bleiben und mich ihr anzunehmen. Ich muss mich nicht angsterfüllt von der Welt abwenden und mich in ein trostreiches kleines Reservat Gleichgläubiger zurückziehen, in dem wir uns gegenseitig versichern, dass die Welt uns gestohlen bleiben kann. Denn das ist nicht die Idee.
Wenn ich weiß, dass Jesus, der in mir lebt, die Welt überwunden hat, kann ich offenen Auges und ohne Furcht in dieser Welt stehen. Ich kann mich mitten ins Elend stellen – voller Schmerz und Betroffenheit, voller Tränen und Mitgefühl, aber ohne Furcht. Ich kann ein Krieger für das Gute sein.
Ja, Ihr habt richtig gelesen. Ein Krieger.
Vor einiger Zeit habe ich auf Facebook ein Post geteilt, das unter meinen Freunden eine kleine Kontroverse ausgelöst hat. Es bestand aus zwei Fotos mit Überschrift. Das erste trug den Titel „Wie wir uns Kirche vorstellen“ und zeigte eine von warm schimmernden Duftkerzen umgebene Frau im Schaumbad, der das Wort „Wellness“ virtuell auf die Stirn tätowiert war. Das zweite mit dem Titel „Wie Gott sich Kirche vorstellt“ zeigte einen Soldaten in Uniform, der auf seinen Armen ein verletztes Kind aus einem zerbombten Haus trägt.
Nach dem Teilen des Posts haben viele Freunde mir geschrieben, dass das Bild sie abstößt, weil Gott und Krieg nicht zusammengehörten, weil das nicht zur Botschaft von Liebe und Versöhnung und Frieden passe.
Wenn ich mir ansehe, womit wir uns heute auseinandersetzen, stehe ich nach wie vor hundertprozentig hinter diesem Post, und zwar nicht nur wegen der offensichtlichen Bilder des Krieges aus Paris. Das Bild würde auch dann stimmen, wenn die Anschläge nicht stattgefunden hätten. Krieg ist nicht nur Gewehre, Blut und Tote. Krieg ist auch Missbrauch, Armut, seelische Not, Einsamkeit, Manipulation, Lüge. Das alles sind Elemente, gegen die die Kirche und der einzelne einstehen und angehen müssen. Und vielleicht fällt es uns wegen der schmerzhaften, plakativen Bilder in den Medien heute leichter, diese Wahrheit zu sehen:
DAS ist Kirche. Im Trommelfeuer stehen, Menschen die Wunden verbinden und ihnen beistehen, egal, ob es physische oder psychische Wunden sind. Das Elend, das Leid, den Terror sehen. Und dabei – und vielleicht ist das manchmal das Schwerste von allem – dennoch zu sagen: Ja, ich glaube. Ich glaube an einen allmächtigen, liebenden Gott. Auch heute.
Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz;
Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst.
1. Johannes 4,18 (Neue Genfer Übersetzung 2011)






















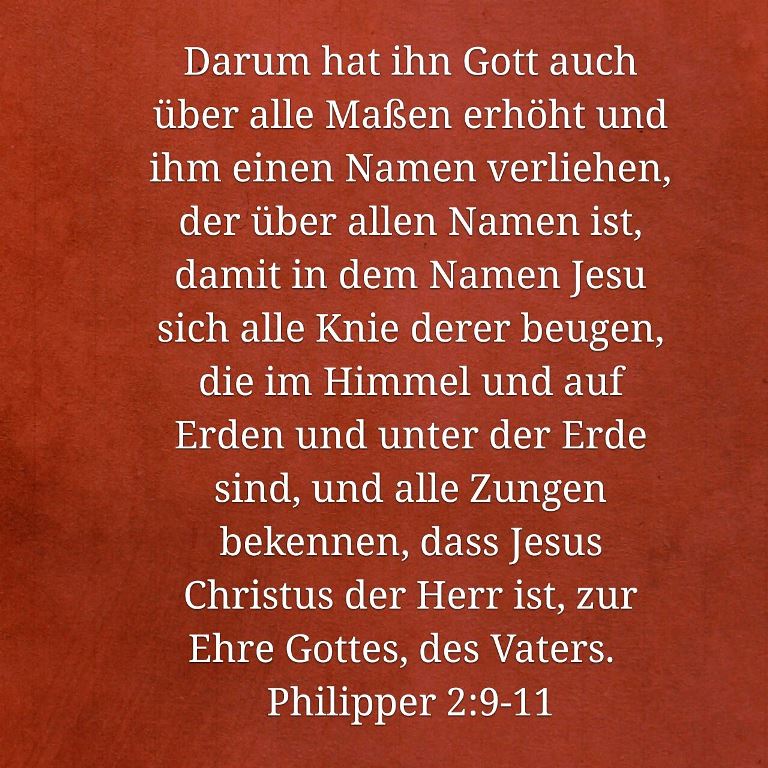


Letzte Kommentare