Nachdem mein Blog in den Ferien etwas Staub angesetzt hat, melde ich mich endlich zurück – seit einer Woche bin ich wieder im Alltag unterwegs. Der Urlaub hat seinen Zweck hinreichend erfüllt; ich fühle mich frisch und der Arbeit, meinem Buchprojekt und allem anderen, was ansteht, wieder einigermaßen gewachsen. In der zweiten Ferienwoche sah es allerdings noch zappenduster aus – und ich hatte erst keine Ahnung warum.
In der ersten Ferienwoche waren wir für einen Kurztrip in Heidelberg. Obwohl wir zu müde waren, um viel zu unternehmen, genossen wir den Aufenthalt. Nach einem ruhigen Wochenende freuten wir uns auf die Uhu-Woche (für Nichtschweizer: Abkürzung für „Ums Hus ume“, d.h. ums Haus herum). Endlich Ruhe, auftanken, Seele baumeln lassen.
Doch es funktionierte nicht.
Unheimlicherweise wurde es in mir jeden Tag dunkler, präziser gesagt: es kam mir vor, als ob kontinuierlich von Tag zu Tag jede Farbe aus meinem Leben herausgesaugt würde. Zuhause normalerweise ein fröhlich-zappeliger, geschwätziger Mensch, verlor ich jeden Humor, und meine Lebensfreude schien tröpfchenweise aus mir herauszusickern. Gleichzeitig türmte sich all das, was ich nach den Ferien und bis Ende Jahr zu bewältigen habe, wieder einmal vor mir auf. Ohne es zu wollen, geriet ich in Panik, und alles Rationalisieren half nichts: Mein Verstand wusste, dass es nicht so schlimm werden würde, aber ich konnte den Rest von mir einfach nicht davon überzeugen. Ich schlich nur noch wie ein geschlagener Hund im Haus herum.
Das Wetter war derweil gnadenlos schön, und ich versuchte resolut, mein armes Ich zur Erkenntnis zu bewegen, dass alles gut ist: „Frau, jetzt guck doch mal – die SONNE SCHEINT! Der Himmel ist BLAU! Du hast FERIEN! Jetzt FREU Dich doch!“
Aber es freute sich einfach nicht. Meine Augen sahen den blauen Himmel und die Sonne, die blühenden Sträucher, aber es war, als ob mein Hirn diese Daten nicht übersetzen könnte – als ob zwischen meinen Ohren nur eine dumpfe Masse saß, die keine Daten weitergab.
Es waren zwar nur ein paar Tage, aber dieses Gefühl oder besser Nichtgefühl war mir so unvertraut, dass ich es mit der Angst bekam. Ich hatte so etwas noch nie erlebt und begann mich zu fragen, ob ich mein Gehirn untersuchen lassen muss. Schließlich hatte ich keinen Grund für dieses Tief – alles war in Ordnung.
Alles außer einer Kleinigkeit. Etwas war anders als sonst, und als mir die Idee kam, dass mein Zustand damit zusammenhängen könnte, dämmerte ein Quentchen Hoffnung in mir auf.
Seit Ende Mai lassen wir unsere Fassade renovieren. Ursprünglich waren sieben Wochen vorgesehen, dann kam der „Große Regen“, und die Arbeiten gingen nicht voran. Unser Plan war gewesen, dass wir zwei Wochen Ferien in unserem schön renovierten Haus verbringen würden, aber langsam war uns klargeworden, dass das so nicht klappen würde. Wir begannen uns mental darauf vorzubereiten und planten den kleinen Heidelbergtrip in der Hoffnung, bei unserer Rückkehr sei das Ganze vielleicht doch erledigt. Doch dem war nicht so, und unsere Home-Holiday-Woche sah dann notgedrungen etwas anders aus:
Um 7.15 war Tagwache, weil dann die Arbeiten begannen. Vor dem Duschen mussten wir Türen und Fenster schließen, um beiderseits unerwünschte Blicke auf nackte Tatsachen zu verhindern. Beim Kaffeeholen grüßte uns der erste Maler freundlich durchs Küchenfenster. Manchmal klingelte es vor der Morgendusche, weil irgendetwas besprochen werden musste. Selbst wenn ich im oberen Stock im Musikzimmer hinter meinem PC saß, lief alle Naselang jemand vor meinem Fenster vorbei.
Das alles kannten wir seit Ende Mai, nur waren wir da nicht immer zuhause – ich arbeite an zwei Tagen ganz auswärts und an zwei weiteren halbtags, und wenn wir am Abend heimkamen, hatten wir das Haus wieder für uns. Jetzt konnten wir nur fliehen, wenn wir unsere Ruhe wollten. In diesen Tagen begann ich schließlich zu vermuten, dass mir die ununterbrochene Anwesenheit fremder Leuten zusetzte, und das nährte die leise Hoffnung, dass es auch wieder anders werden könnte.
Das Wetter war auf unserer Seite: Die Arbeiter kamen gut voran und begannen am Donnerstag mit dem Abbau des Gerüsts. Am Freitag war es weg, und wir nahmen einen Umtrunk und Imbiss mit der Crew, im seligen Wissen, dass nun inklusive Feiertag drei ungestörte Tage vor uns lagen. Und das Wunder nahm seinen Lauf: Schon am Freitagabend ging es mir um Welten besser, und am Samstagmorgen war ich so erleichtert wie schon lange nicht mehr. Der dunkle Deckel hatte sich gelüftet – ich war „zurück“.
Das Erlebnis hat mir einmal mehr gezeigt, wie wichtig das Alleinsein für mein mentales Gleichgewicht ist. Es hat mir aber auch klar gemacht, dass ich nicht immun gegen irrationale Gefühle bin – eine ernüchternde und auch etwas beschäme Erkenntnis für mich. Ich mache anderen gern mal stille Vorwürfe , wenn sie nicht „vernünftig“ reagieren und ihre Stimmungen nicht logisch sind oder in einem meiner Ansicht nach unangemessenen Verhältnis zur Realität stehen. Zu diesen Vorwürfen gesellt sich dann auch gern ein Gefühl der Überlegenheit und der Glaube, zwar nicht gefühlarm zu sein, aber meine Emotionen stets unter Kontrolle zu haben und von purer Logik geleitet zu sein.
Oh Irrtum – mein Hirn tat in diesen Tagen sein Bestes, um den Rest von mir zu überzeugen, dass alles gut ist, und es versagte kläglich. Ich konnte meine Gefühle oder Nicht-Gefühle nicht ändern, und ich habe für einmal am eigenen Leib gespürt, dass das Hirn aller Logik zum Trotz manchmal einfach den Kürzeren zieht.
 Gestern Mittag habe ich mit meinem Vater in Solothurn zu Mittag gegessen und danach die St. Ursen-Kathedrale und die steinernen Skulpturen und kleinen Brunnen neben der Treppe bewundert. Glitzernde Wassertropfen funkelten in der Sonne und hoben sich vom blauen Mittagshimmel ab – ein wunderschönes Bild. Um halb sechs bin ich mit dem Auto von der Arbeit nach Hause gefahren. Der Weg geht gen Westen, und ich fuhr gemächlich auf der Landstraße in die Abendsonne. Die bewaldeten Jurahügel begleiteten mich in sanften, dunkelgrünen Wellen, davor glänzten grüne Maisfelder. Und als Grenchen langsam näher kam, tauchten hinter dem Bucheggberg die „Schneeberge“ auf – die Berner Alpen. Weißleuchtend, mächtig, zum Anfassen nah in der klaren Luft. Meine Augen sahen sich das alles an, gaben es an mein Hirn weiter, und mein Hirn freute sich, und mein Herz weitete sich, und ich spürte den Frieden und die Pracht dieses Abends bis in den kleinen Zeh.
Gestern Mittag habe ich mit meinem Vater in Solothurn zu Mittag gegessen und danach die St. Ursen-Kathedrale und die steinernen Skulpturen und kleinen Brunnen neben der Treppe bewundert. Glitzernde Wassertropfen funkelten in der Sonne und hoben sich vom blauen Mittagshimmel ab – ein wunderschönes Bild. Um halb sechs bin ich mit dem Auto von der Arbeit nach Hause gefahren. Der Weg geht gen Westen, und ich fuhr gemächlich auf der Landstraße in die Abendsonne. Die bewaldeten Jurahügel begleiteten mich in sanften, dunkelgrünen Wellen, davor glänzten grüne Maisfelder. Und als Grenchen langsam näher kam, tauchten hinter dem Bucheggberg die „Schneeberge“ auf – die Berner Alpen. Weißleuchtend, mächtig, zum Anfassen nah in der klaren Luft. Meine Augen sahen sich das alles an, gaben es an mein Hirn weiter, und mein Hirn freute sich, und mein Herz weitete sich, und ich spürte den Frieden und die Pracht dieses Abends bis in den kleinen Zeh.
Ich bin so dankbar, dass ich solche Momente genießen,
mich an ihnen erfreuen und darin auftanken kann.
Und ich werde das nie mehr als selbstverständlich ansehen.








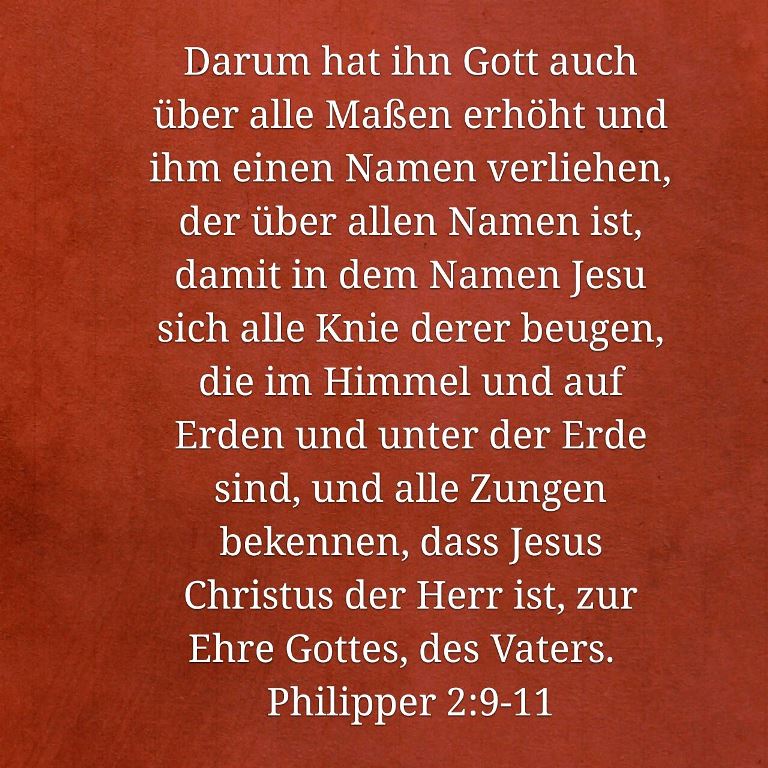
Letzte Kommentare