Heiligabend ist da, und wie jedes Jahr will ich zu diesem Freudentag ein Post verfassen. Aber einfach ist es dieses Jahr nicht. Die Welt wirkt zerbrochen, und das nicht nur wegen des Terrors, dwe diese Vorweihnachtswoche überschattet hat.
Wir möchten die Geschichte der Menschheit als aufwärtsführenden Pfad sehen, auf dem sich der Mensch Stück für Stück weiterentwickelt. Aber obwohl der Mensch in bestimmten Epochen immer wieder über sich hinausgewachsen ist und die weltweiten Zahlen zu Kindersterblichkeit, Ausbildung und extremer Armut heute viel besser aussehen als vor 200 Jahren, lässt mich der Blick in die Jahrhunderte, in die jüngste Vergangenheit und auf die Gegenwart ernüchtert zurück. Wenn ich mir die Kriege und Greuel seit dem Zweiten Weltkrieg, die nackte Gier und den explodierenden Kommerz in der westlichen Welt ansehe, komme ich zu einem bitteren Schluss.
Weder Aufklärung noch wissenschaftlicher Fortschritt noch die durch Globalität verblassenden Grenzen haben den Menschen im Grunde seines Herzens verändert. Ja, er ist fähig zu Güte, zu Grosszügigkeit und Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Selbstlosigkeit, aber im tiefsten Grund seines Herzens sieht er nur sich selbst und ist oft nicht willens, sich nur ein Jota in einen anderen Menschen hineinzuversetzen. Und die wissenschaftlichen Fortschritte haben dieses Wesen voller Machtstreben, Egoismus und Gier mit abertausenden neuer Möglichkeiten ausgestattet, seinen Willen durchzusetzen und andere zu unterdrücken oder zu vernichten.
An diesem Heiligabend 2016 sehe ich eine Welt in Trümmern, die sich vor Schmerzen windet. Eine Welt, die beweist, dass es mit der Sapientia des homo sapiens nicht weit her ist.
Und doch gibt es Gründe, gerade jetzt Weihnachten zu feiern.
Auch die erste Weihnacht ist in eine Zeit und eine Region des Aufruhrs gefallen. Gott hat nicht auf einen schönen und erhabenen Moment der Menschheitsgeschichte gewartet, um sich zu uns zu begeben – er kam mitten in das Chaos hinein.
Und so bedrückend und beängstigend wir diese Zeit empfinden mögen: In der Erkenntnis der menschlichen Grenzen und der menschlichen Widerborstigkeit, der sich wiederholenden Zyklen in der Menschheitsgeschichte, liegt ein gleichzeitig ernüchternder wie befreiender Gedanke: Der, dass unser hehres Geschlecht der Aufrechtgehenden, so sehr es das auch versucht, sich nicht selbst erlösen kann.
Und wir versuchen es unaufhörlich. Der moderne Mensch, der sich meist weigert, an einen Gott zu glauben, der ihn erlösen muss, lebt nicht frei und fröhlich vor sich hin, sondern verdammt, rechtfertigt und erlöst sich selbst in einem fort. Dieser Gedanke ist nicht von mir; ich habe ihn aus einem Blogbeitrag von Christof Lenzen, der ihn wiederum aus einem Vortrag von Andreas Malessa hat.
Der Mensch braucht auch keine Hölle mehr, denn er lebt bereits in einer. Er steht unter dem Druck, ein Leben zu leben, das „Erfolg“ ausstrahlt, er versucht, all den zivilisatorischen Regeln zu folgen, die mindestens so religiös verbrämt daherkommen wie die Zehn Gebote, und weil er nicht genügen kann, muss er sich immer wieder freisprechen. Das ist anstrengend, und vor allem funktioniert es nicht. Und genau hier liegt die harte, aber befreiende Erkenntnis:
Wir brauchen Gott. Allein können wir es nicht und werden es nie können.
Aber wir müssen auch nicht, denn genau das bedeutet „Gnade allein“. Und an Weihnachten folgt, passend zum anstehenden Luther-Jahr, neben dem „Sola Gratia“ der Blick auf die Krippe, auf das „Solus Christus“. Nur Christus kann uns erlösen, nur durch ihn haben wir den Zugang zum Vater, die Erlösung der Sünde. Diese Aussage kann einengend und selbstgerecht wirken, aber diese Selbstgerechtigkeit wird dadurch aufgehoben, dass dieses Angebot allen Menschen gilt.
Ich feiere heute auch meine eigene Begegnung mit Jesus. Ich feiere, dass ich in den Jahren, in denen ich ihm in all meiner Unbeholfenheit und Widerborstigkeit gefolgt bin, schon viel Befreiung habe erleben dürfen. Was ich über das Menschengeschlecht gesagt habe, trifft auch auf mich zu – ich kann bösartig, rechthaberisch, egoistisch und ungeduldig sein und kann auf andere herunterblicken, und manchmal fällt mir das leichter, als gütig und geduldig zu sein. Aber immer dann, wenn Güte, wenn Liebe für meine Mitmenschen ohne Ansehen von Rang, Rasse oder Religion natürlich aus mir herausfliesst, weiss ich, dass Gott in mir wirkt.
Mehr als alles andere wünsche ich mir, dass die Angst und das Dunkel dieser Zeit Menschen zu Gott führen. Dadurch wird nicht sofort alles anders, aber wenn Menschen sein Angebot annehmen, sich berühren, heilen und verändern lassen, dann besteht Hoffnung für die Zukunft.
Wir können nicht, aber ER kann. ER kann in UNS. Und je mehr wir uns von ihm leiten lassen, desto stärker wird sein Reich sichtbar. Wo die Welt aufklafft, wo sich Wunden auftun, öffnet sich auch immer Raum für das Licht. Das Licht, das von ihm kommt, das Licht, das uns vor zweitausend Jahren erschienen ist. Das Echte Licht.
Ich wünsche Euch allen eine segensreiche, lichtvolle Weihnachtszeit.
Be blessed!


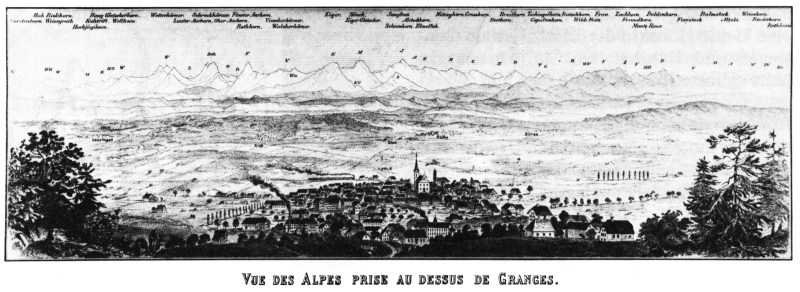
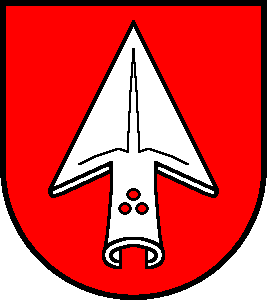



Letzte Kommentare