Heute ist Muttertag, und da ich keinen Anspruch darauf habe, deshalb gefeiert zu werden, stimme ich ein in den Lobgesang auf die Mütter.
Sie haben es nicht leicht – heute genauso wenig oder noch weniger als früher. Von allen Seiten hören sie, wie man es machen sollte, und jeder weiss es besser. Selbst ich als Kinderlose kriege über Posts von befreundeten Bloggerinnen mit, was für Grabenkämpfe ausgetragen werden, und bei all den Ideologien, die da aufeinanderprallen, grenzt es an ein Wunder, dass noch nie ein offener Krieg ausgebrochen ist.
Ob, wie lange und wo gestillt wird, ob man zu Hause bleibt oder auch auswärts arbeitet – diese Fragen entscheiden für manche Menschen darüber, ob eine Frau eine gute Mutter ist und ob sie die richtigen Prioritäten setzt. Und wie beim Schweizer Militär, wo sich jeder, der mal Dienst geleistet hat, für einen Experten hält, glaubt auch jeder, zur Erziehung fremder Kinder sein Scherflein beitragen zu können. Jede Mutter wird in der Öffentlichkeit begutachtet und kostenlos, unaufgefordert und aufdringlich beraten.
Aber seien wir mal ehrlich: Was ist wirklich wichtig? Woran erinnern wir uns heute, wenn wir an unsere Mütter denken?
Ich glaube, ich wurde gestillt, aber erinnern kann ich mich daran nicht. Meine Mutter war die ersten Jahre zuhause, und ich fand es schön, dass sie da war, wenn ich nach Hause kam – ausser an dem Tag, als ich auf dem Nachhauseweg getrödelt und mich eine halbe Stunde zum Mittagessen verspätet habe, worauf ich von meiner Mutter, die mich vor ihrem inneren Auge schon unter den Rädern eines Autos gesehen hatte, ein riesiges Donnerwetter zu hören bekam.
Ich glaube, am Ende zählen diese Fragen weit weniger, als wir uns vorstellen. Wenn ich an das Wichtigste denke, was meine Mutter mir mitgegeben hat, brauche ich nicht lange zu suchen. Es war die eine Gewissheit, die ich aus dem, was sie mir weitergegeben hat, verinnerlicht habe.
Ich bin geliebt. So wie ich bin. Immer.
Hat sich meine Mutter nie über mich aufgeregt? Na und ob! Ich war ein ruhiges, introvertiertes Kind, aber ich hatte ein paar nervöse Ticks auf Lager wie auf den Oberschenkeln herumtrommeln, laut pfeifen und andere Freuden, und ich habe ab und zu den Satz gehört, ich solle doch bitte „normal tun“. Dennoch wusste ich immer, dass sie mich annimmt, wie ich bin. In den kritischen Teenagerjahren, in denen ich so gern super beliebt gewesen wäre und gleichzeitig einfach sein wollte, wie ich bin (was zusammen irgendwie nicht funktionierte), hat sie mir immer wieder geduldig eingetrichtert, dass ich so völlig in Ordnung bin. Dass ich wertvoll bin.
Es gibt, so habe ich auf Facebook gelesen, nur eine Art, eine perfekte Mutter, aber tausende von Arten, eine gute Mutter zu sein. Für mich ist die gute Mutter nicht die, die dies oder jenes tut oder sein lässt. Es ist die, die ihre Kinder spüren lässt, dass sie sie liebt, wie sie sind.
Liebe Mütter, lasst Euch nicht verrückt machen. Ihr tut ein wichtiges Werk; eines der wichtigsten überhaupt. Lasst Euch heute feiern, wenn Ihr könnt. Und wenn Ihr niemanden habt, der Euch heute feiert – feiert Euch selbst und nehmt auch meine guten Wünsche an.
Und liebe „Kinder“ (denn das bleiben wir für unsere Mütter ja immer): Gedenkt heute Euren Müttern. Erinnert Euch an das Wertvolle, an die schönen Erinnerungen, an das, wofür Ihr dankbar seid. Vergebt Ihnen das „andere“. Und wenn Ihr das Glück habt, das Eure Mutter noch lebt: Lasst sie wissen, dass Ihr dankbar seid, am besten persönlich. Ihr wisst nicht, wieviel Zeit Ihr dafür noch habt.
Ich habe geschrieben, Ihr sollt das „andere“ vergeben – im Wissen, dass alle Menschen Fehler machen und jede Kindheit Erfahrungen mit sich bringt, auf die man gern verzichtet hätte. Ich denke daher auch an die unter Euch, die nicht viel haben, für das sie dankbar sind und deren Kindheit vor allem durch negative Erfahrungen geprägt sind: Lasst Euch von diesem Tag nicht niederdrücken, und lasst Euch kein schlechtes Gewissen auferlegen, wenn Ihr nicht (oder noch nicht) vergeben könnt. Streckt Euch danach aus, da Vergeben können vor allem uns selbst befreit; aber nehmt Euch die Zeit, die Ihr dafür braucht.
Beziehungen sind das Salz in unserem Leben, aber auch das, woran wir uns reiben und woran wir geschliffen werden. Sie schenken uns das Gefühl, verstanden und geliebt zu werden, brechen uns aber auch immer mal wieder das Herz; und die Beziehungen in der Familie sind in dieser Hinsicht besonders intensiv. Niemand kann uns mehr verletzen oder ermutigen, keine Bemerkung nehmen wir persönlicher – in positiver wie negativer Art – als eine, die aus der Familie kommt.
 Ich bin heute dankbar für das, was meine Mutter mir zu Lebzeiten gegeben hat, und danke Gott für all meine Lieben, die ich noch um mich habe. Be all blessed – and take care!
Ich bin heute dankbar für das, was meine Mutter mir zu Lebzeiten gegeben hat, und danke Gott für all meine Lieben, die ich noch um mich habe. Be all blessed – and take care!
Wie geht es Dir am Muttertag? Welche Erinnerung an Deine Mutter ist Deine liebste, und welche Eigenschaft an ihr liebst Du besonders? Ich freue mich auf Deinen Kommentar und wünsche Dir einen schönen Muttertag!






 Mir geht alles Mögliche im Kopf herum, an dem ich Euch teilhaben lassen möchte, aber heute freue ich mich, Euch den „Liebster Blog Award“ ans Herz zu legen – vor allem, weil ich wieder einmal nominiert wurde (Freude herrscht!) Der LBA ist eine Initiative, die kleineren Blogs helfen soll, ein bisschen Aufmerksamkeit zu erlangen, und dieses Jahr hat mich Sandra von
Mir geht alles Mögliche im Kopf herum, an dem ich Euch teilhaben lassen möchte, aber heute freue ich mich, Euch den „Liebster Blog Award“ ans Herz zu legen – vor allem, weil ich wieder einmal nominiert wurde (Freude herrscht!) Der LBA ist eine Initiative, die kleineren Blogs helfen soll, ein bisschen Aufmerksamkeit zu erlangen, und dieses Jahr hat mich Sandra von 
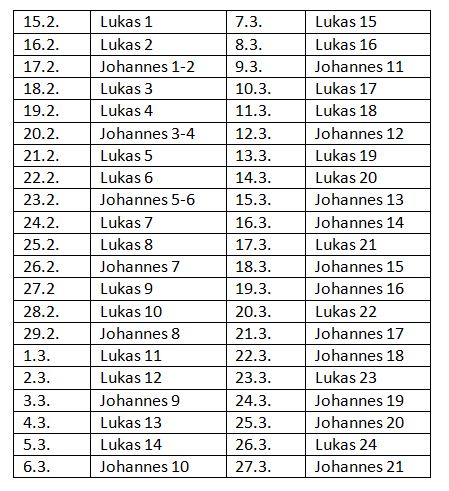

Letzte Kommentare